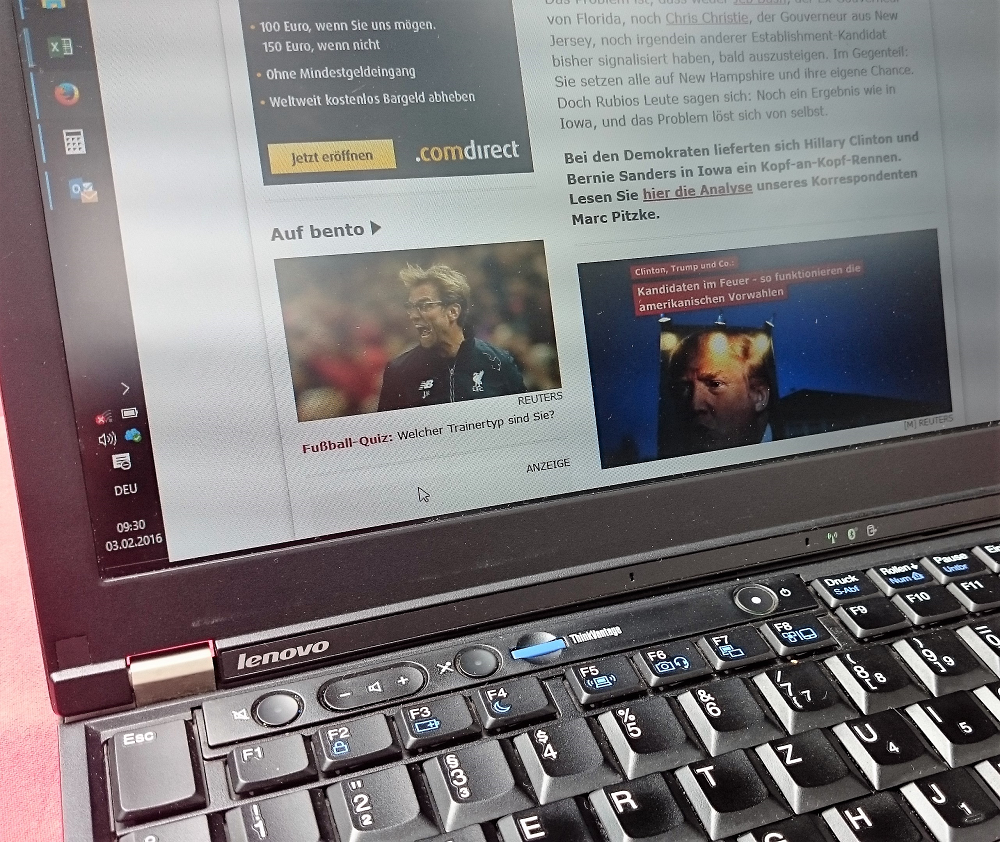Das Rätsel der verschwundenen Babysitter
Mr Sherlock Holmes 221B Baker Street London Verehrter Mr Holmes, durch die Berichte Ihres Freundes und Kollegen Dr. Watson ist Ihr Verlangen nach intellektuellen Herausforderungen allgemein bekannt. Bisher war ich nur ein still genießender Konsument Ihrer Fälle, bot doch mein Leben keinerlei erwähnenswerte Mysterien. Nun aber hat sich innerhalb kürzester Zeit eine Reihe seltsamer Vorfälle zugetragen, die ich Ihnen gerne schildern möchte und hoffe dabei … Weiterlesen