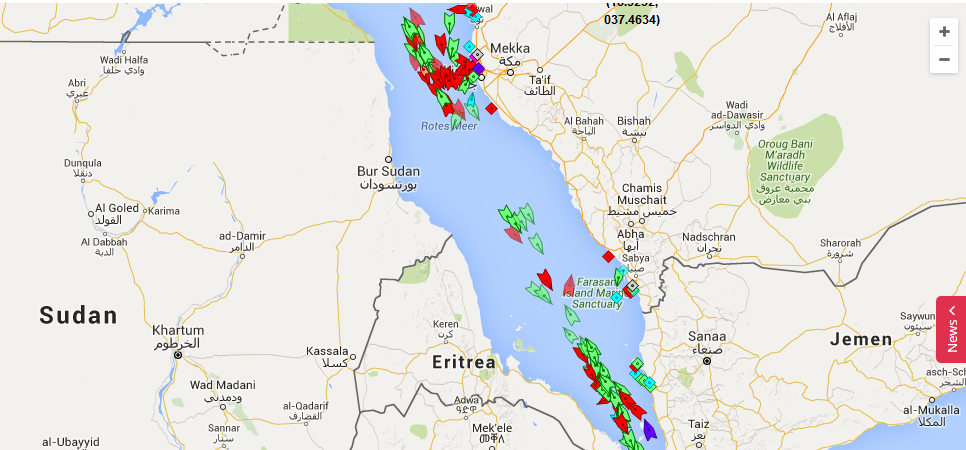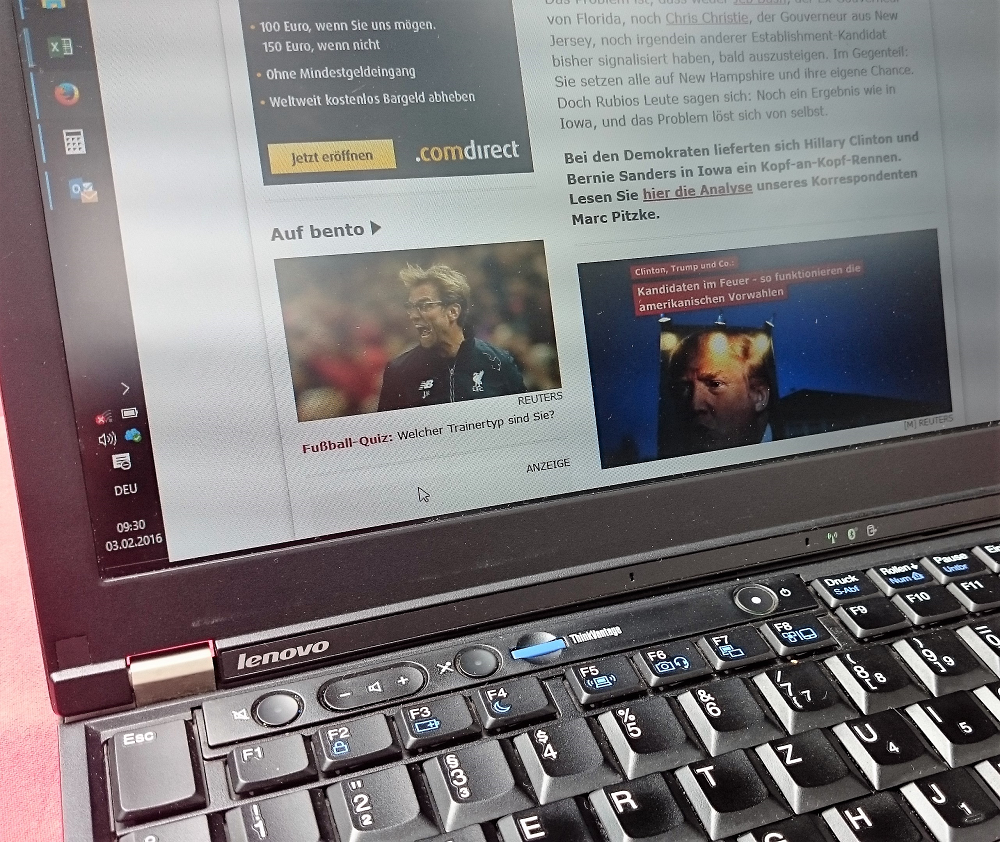Lob des stationären Handels. Nicht.
Eigentlich wollte ich ab sofort nett sein. Wollte den stationären Handel nicht bashen. Nach meiner Rückkehr aus Afrika bodenständig werden. Amazon & Co. abschwören. Nicht mehr global, sondern regional oder lokal einkaufen. Doch dann fuhr ich mit dem Auto und der dreijährigen Bb auf dem Rücksitz nach Frankfurt, und alles kam ganz anders. Eine Freundin, die auch in meiner neuen kleinen hessischen Heimatstadt wohnt, schimpfte … Weiterlesen