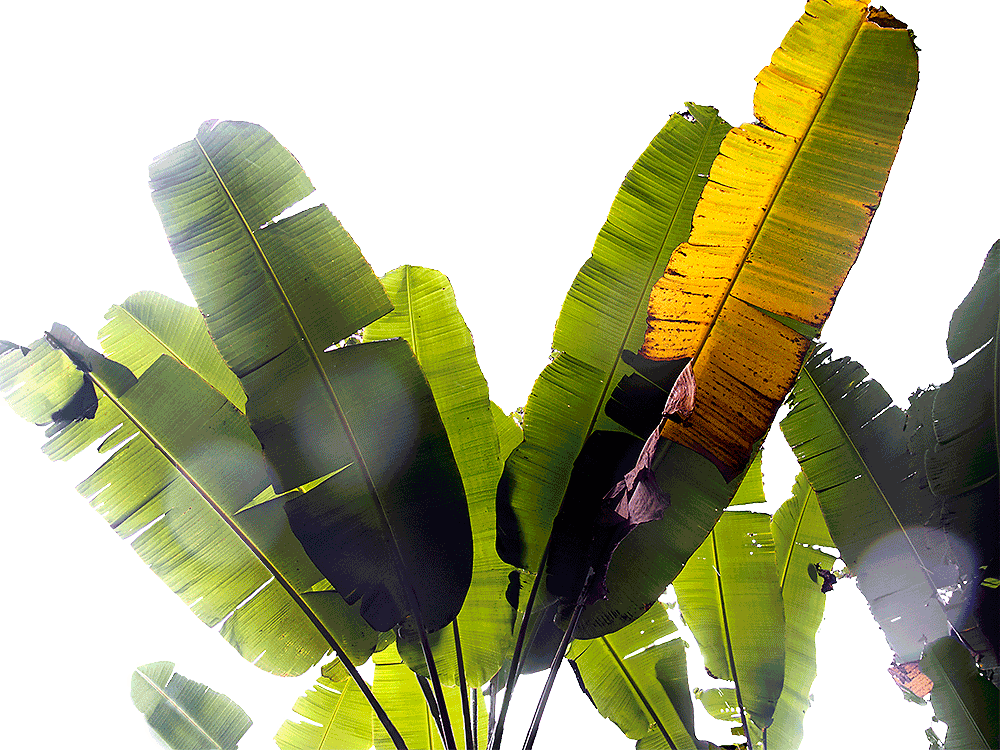Vor zwei Jahren blieb ich bei einem Besuch des Fort Jesus in Mombasa mit dem Ärmel meines Hemdes an einem rostigen Nagel des Eingangstores hängen. Das Hemd hatte sich Jahre zuvor in der ghananischen Hitze dank seines unerklärlichen (es besteht einfach nur aus Baumwolle), aber günstigen Mikroklimas zu meinem Lieblingshemd entwickelt. Es machte “ratsch”, und der Ärmel hatte einen Riss. Normalweise wäre dies das “Aus” für jedes andere Hemd gewesen. Da ich es aber so lieb gewonnen hatte, konnte ich mich nicht dazudurchringen, es einfach wegzuwerfen. Also hängte ich es in den Schrank und wartete – ja, worauf? – wahrscheinlich auf eine Idee. Diese kam in Gestalt von Jane, einer Schneiderin, die für uns hin und wieder Gardinen näht oder Reißverschlüsse repariert. Als sie vor einer Woche mal wieder bei uns war, erinnerte ich mich an das Ex-Lieblingshemd, zog es aus dem Schrank und drückte es ihr mit den Worten in die Hand, sie möge doch irgendeinen Flicken – oder so – auf den Riss nähen, ihr fiele doch bestimmt etwas passendes ein.